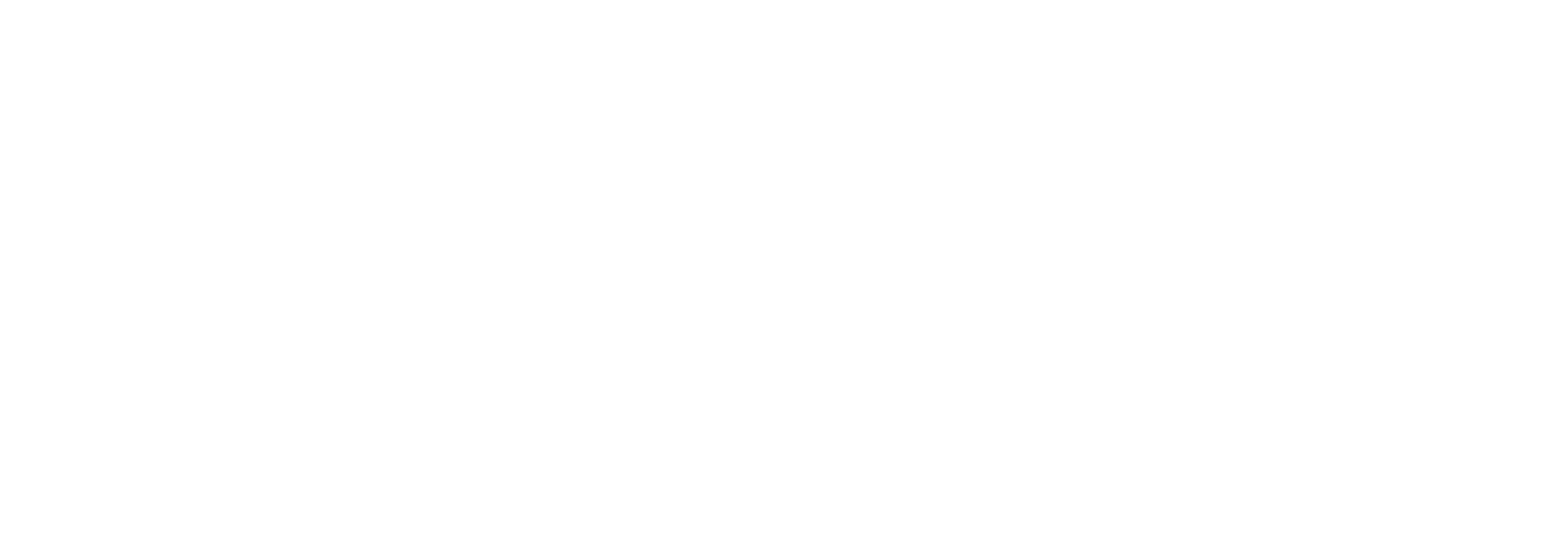Digital People: Fünf Fragen, fünf Antworten. Folge 4: Dr. Bettina-Johanna Krings
Dr. Bettina-Johanna Krings arbeitet als Leiterin des Forschungsbereiches Wissensgesellschaft und Wissenspolitik am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) des KIT, an dem wissenschaftliche und technische Entwicklungen, ihre Verquickung und ihre Folgen, insbesondere im Hinblick auf die soziale Dimension erforscht werden. Über ihre Tätigkeit am ITAS hinaus ist Dr. Krings stellvertretende Sprecherin des Topics „Arbeit und Technik“ im Rahmen des Schwerpunktes „Mensch und Technik“ des Karlsruher Instituts für Technologie. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Mensch-Maschine-Relation und damit, welche Auswirkungen technische Innovationen und Digitalisierung auf Arbeitsstrukturen haben und wie diese die Zukunft der Arbeit gestalten werden. Für „Digital people“ haken wir nicht nur nach, wie die entstehenden Probleme durch den Digitalisierungsprozess im Arbeitskontext aussehen, sondern wir fragen auch nach der Rolle, die die akademische Lehre angesichts der Veränderungen der Arbeitswelten einnehmen sollte und wie das KIT als Hochschule einen Diskurs vorantreiben kann, der ein humanes und identitätsstiftendes Konzept von Arbeit befördert.
1) Die Digitalisierung gehört zu den Feldern, die derzeit am intensivsten öffentlich diskutiert werden. Viele sehen sie als Erfolgstory. Sie sind da eher skeptisch. Warum ist es wichtig, den Digitalisierungsprozess mit Blick auf unterschiedliche Arbeitswelten zu analysieren? Und wo sehen Sie persönlich Probleme und Anpassungsnotwendigkeiten in diesem Prozess?
Zum einen gibt es nicht den einen benennbaren und beobachtbaren Digitalisierungsprozess. Wir reden von einer Synthese unterschiedlicher technischer Felder, die seit einigen Jahrzehnten erfolgreich zusammengeführt werden und ganz verschiedene Einsatzfelder, Wirkungsweisen und Auswirkungen hervorbringen. Je nachdem auf was wir schauen, charakterisieren wir „Digitalisierung“ und das können sehr unterschiedliche Phänomene sein. Diese bringen seit Jahrzehnten große Veränderungen auf der betrieblichen, organisatorischen und individuellen Arbeitsebene hervor. Ich finde, diese Prozesse sollten (noch) systematischer untersucht werden, hier fehlt einfach noch viel Wissen im Hinblick auf die Transformationsprozesse in sehr unterschiedlichen Branchen wie beispielsweise der Verwaltung, Landwirtschaft oder dem medizinischen Bereich. In der Regel werden die technischen Impulse gesetzt und Innovationen in Arbeitsumgebungen eingeführt, die Anpassungsnotwendigkeiten dann ex-post ermittelt und gegebenenfalls integriert. Das ist eigentlich der ganz normale Lauf der Technisierung bzw. Rationalisierung von Arbeit. Im Hinblick auf nachhaltige, sozialverträgliche Perspektiven könnte man auch umgekehrt vorgehen und zunächst fragen, wie wir in unterschiedlichen Bereichen Arbeitsstrukturen sozialverträglicher, solidarischer und ökologischer gestalten könnten, um dann Technologien entsprechend behutsam, in langsamen Schritten, einzusetzen. Aber ja, das wäre fast ein Paradigmenwechsel.
2) In Ihrem Aufsatz „Digitalisiert, effizient & global?“ konstatieren Sie, dass durch die Digitalisierung ein Prozess einsetzte, der „vor wenigen Jahrzehnten undenkbar schien, nämlich, dass wissensbasierte und qualifizierte Tätigkeiten ebenfalls von Rationalisierungsmaßnahmen erfasst und in einzelne Arbeitsvorgänge zerlegt werden können“, wodurch im Endeffekt eine „Entgrenzung von Erwerbsarbeit“ stattfindet. Wie müsste ein Studium am KIT die qualifizierten Arbeitskräfte von morgen adäquat auf die neuen Formen der Arbeit vorbereiten?
Für mich weisen die Herausforderungen der zukünftigen Arbeitsmärkte auf das durch Humboldt geprägte Bildungsideal, für das die akademische Ausbildungslandschaft Deutschlands lange Zeit stand: solide fachliche und dennoch breit angelegte Grundausbildung sowie die Ermächtigung zur individuellen Urteilskraft. Das heißt, der Ausbildungskanon war lange Zeit so angelegt, dass die Studierenden Zeit hatten, sich breit zu bilden und eigene Interessen und wissenschaftliche Fragestellungen zu entwickeln. Sie konnten Impulse anderer Disziplinen aufnehmen, indem sie Seminare aus anderen Studiengängen sowie dem Studium Generale belegten. Sie konnten den Mut entwickeln, Studiengänge zu wechseln oder sogar aufzugeben. Durch den Bologna-Prozess haben sich die Studienzeiten verkürzt, gleichzeitig ist das Studium sehr stark auf bestimmte Formate zugeschnitten, die selbstständiges Arbeiten, die Entwicklung kreativen Potentials sowie das „über-den-Tellerrand-der-eigenen-Disziplin-denken“ deutlich erschwert haben. Dabei sind es genau die oben genannten Fähigkeiten, die in einer komplexer und unsicher werdenden Welt bedeutsamer werden. Neben dem fachlichen Können, das in der Universität vermittelt wird, sollten die Studierenden auch wichtige Impulse erhalten, um Reflexivität, Kreativität und Mut auszubilden, also eher individuelle Fähigkeiten oder so genannte social skills. Gleichzeitig finde ich ein oder zwei Auslandssemester wichtig, um neue Aspekte und Impulse für die eigenen Studiengänge zu erhalten und persönliche Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen zu sammeln.
3) Sie bedauern in einem Interview zu einer „Arbeitswelten der Zukunft“-Diskussionswerkstatt, dass es vor allem ingenieurwissenschaftliche Konzepte seien, die die Arbeitsumgebungen im Rahmen der Vision Industrie 4.0 und fortlaufender Digitalisierungstrends bestimmen. Alternative, soziale Visionen und Vorstellungen zur Ausgestaltung von Arbeitsräumen, die auf die Humanisierung der Arbeit zielen, kämen wenig oder nicht vor. Wie könnten die Lern- und Gestaltungsprozesse mit Beteiligung der Beschäftigten aussehen, die Sie für notwendig halten, um identitätsstiftende Formen des Arbeitshandelns auch in der Industrie zu schaffen und wie kann sich das KIT in den notwendigen Diskurs einbringen – eventuell auch mit digitalen Instrumenten?
Das ist ein Thema, mit dem wir uns gerade in dem Projekt „SynErgie“ im Energiebereich intensiv auseinandersetzen. Partizipative Technikentwicklung war vor allem in den 1980er Jahren ein großes Thema, da es in dieser Zeit aufgrund massiver Rationalisierungsmaßnahmen enorme soziale Verwerfungen (und Entlassungswellen) in Deutschland gab. Im Rahmen der Industrie 4.0-Debatte spielt diese Diskussion aktuell wieder eine Rolle. In Pilotprojekten probieren Mitarbeiter*innen neue Technologien für Feedback aus, zum Beispiel durch ‚Wearables‘, also digitale Geräte wie etwa Brillen oder Armbänder, die am Körper getragen werden und zusätzliche Informationen vermitteln, die just in time in den Arbeitsprozess integriert werden (sollen). Diese Feedback-Runden werden dann in den technischen Entwicklungsprozess konstruktiv eingespeist. Gleichzeitig finden jedoch auch die ganz normalen Innovationsprozesse statt, die gewöhnliche Anpassungsleistungen der Mitarbeiter erforderlich machen. Diese sind in die strategische Investitionslogik der Unternehmen eingebunden und hier werden auch die Betriebsräte einbezogen, die in der Regel jedoch dieser Logik folgen. Ich denke, es wäre wichtig, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es am Ende die Mitarbeiter*innen sind, die mit diesen neuen Technologien arbeiten müssen. Die Akzeptanz von ihrer Seite bestimmt den Erfolg oder Misserfolg dieser Technologien mit. Es sollten (zumindest?) kleine Schritte in Richtung ‚partizipative Technikentwicklung‘ in den Betrieben unternommen werden.
4) Die Vision der Industrie 4.0 geht davon aus, dass Maschinen untereinander Informationen in Echtzeit austauschen und sich langfristig weitgehend selbstständig steuern. Von einer „Verschmelzung" von physischen und digitalen Systemen zu einem Netzwerk ist die Rede, die manche als bedrohlich empfinden. Auch in der Lehre im Studium werden solche Verschmelzungsansätze angedacht – am KIT zum Beispiel die sinnvolle Verschränkung von realem und virtuellem Campus im Rahmen der Dachstrategie. Welche Rolle könnte der arbeitende bzw. der studierende Mensch in diesem „Verschmelzungsszenario“ spielen?
Das ist bisher wenig erforscht: Die Rede ist aktuell eher von einem kooperierenden Verhältnis der Mensch-Maschine-Interaktion. Allerdings zeigen die Erfahrungen bisher, dass das Verhältnis alle Formen der Mensch-Maschine-Interaktionen hervorbringt:
1) Verhältnisse der Substitution (Menschen werden ersetzt);
2) Verhältnisse der Dominanz (Menschen werden zu „Handlangern“ der Maschinen etwa im Produktionsprozess);
3) Verhältnisse der Kooperation (Menschen kooperieren mit den Maschinen wie beim Autofahren);
4) Verhältnisse der Assistenz (Maschinen werden zum Assistenten des Menschen etwa im medizinischen Bereich).
Inwieweit und ob eine Verschmelzung stattfindet, ist in der Literatur hoch umstritten. Was heißt Verschmelzung überhaupt? Wer geht worin auf? Ich würde das „Verschmelzungsszenario“ skeptisch sehen. Freilich gibt es digitale und analoge Sphären, die aufeinander bezogen sind. Der studierende Mensch bleibt ein menschliches Wesen mit einem Körper und kognitiven, psychischen und emotionalen Fähigkeiten, die Nutzung von digitalen Lehrangeboten machen ihn deshalb noch lange nicht zu einem „Cyborg“.
5) Und zum Schluss noch eine „persönliche“ Frage – zur Digitalisierung Ihres Alltages: Welche Webanwendungen finden Sie bereichernd, wenn Sie im Netz – beruflich oder privat – unterwegs sind?
Ich benutze ganz normal das Internet zum Recherchieren, Arbeiten etc. Privat nutze ich What’s App auf meinem Smartphone für die private Kommunikation: that’s it.
(NL04/2018)
Vielen Dank, Frau Dr. Krings, für das Interview!