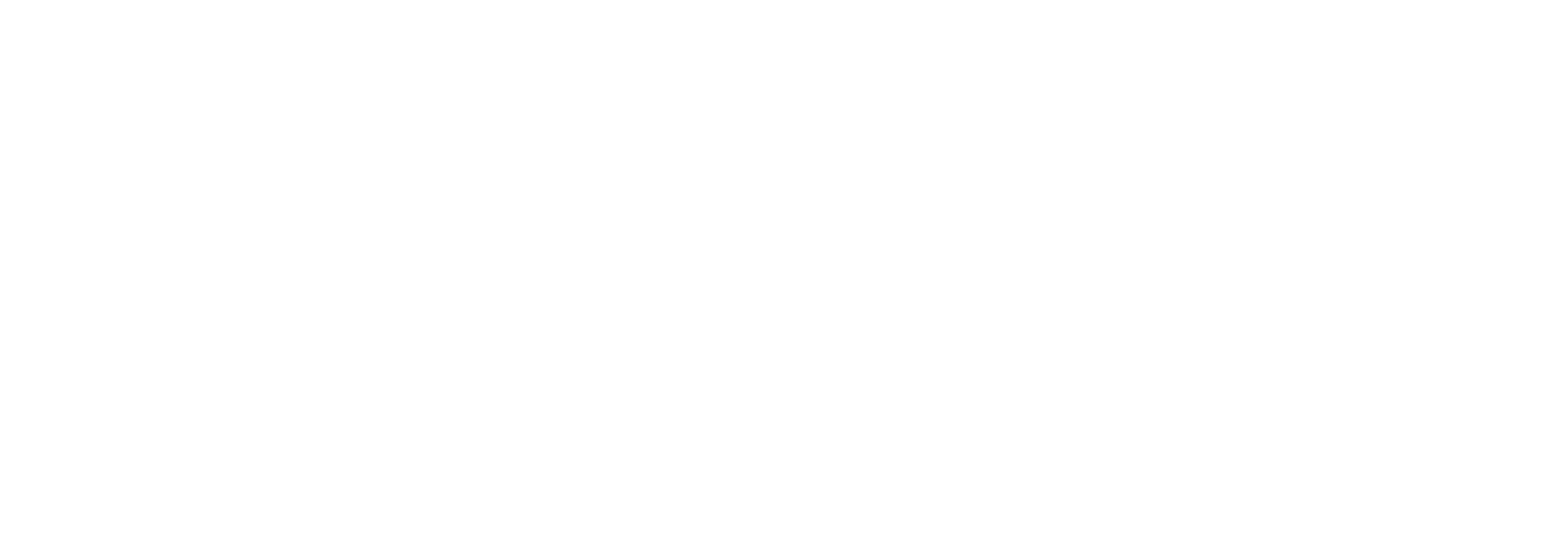Viktoria Fitterer, Leiterin von Campus Services (CSE), und Theresa Schlegel, Leiterin des Facility Managements (FM), verantworten gemeinsam das Digitalisierungsprojekt UP D1 „Lehr- und Lernorte für Lehrende und Lernende“. Im Rahmen dieses Projekts wurde ein Konzept für die medientechnische Sanierung von zentral verwalteten Hörsälen und Seminarräumen am KIT entwickelt.
Das Projekt UP D1 hatte das Ziel, Lehr- und Lernorte am KIT zukunftsfähig auszustatten. Welche zentralen Herausforderungen galt es dabei zu bewältigen?
Viktoria Fitterer: Ganz allgemein fehlt in unseren Lehrräumen die Möglichkeit einer zeitgleichen interaktiven Live-Teilnahme von unterschiedlichen Orten aus über verschiedene Endgeräte. Darüber hinaus sind viele Lernplätze bisher nur unzureichend mit Steckdosen, WLAN, USB-C-Anschlüssen und kabellosen Monitoren ausgestattet. Auch Gruppenarbeitsräume erfüllen die technischen Anforderungen leider nicht.
Theresa Schlegel: Das Projekt sieht deshalb vor, dass nach und nach alle Hörsäle und ein Drittel aller zentral verwalteten Seminarräume umgerüstet werden sollen. Allerdings unterscheiden sich die Räume in ihrer Architektur sehr und müssen deshalb jeweils einzeln betrachtet werden. Das ist aufwendig und wird bis zur vollständigen Modernisierung Auswirkungen auf den Hörsaalbetrieb haben.
Wie werden Dozierende und Studierende konkret von der neuen strukturellen und technischen Ausstattung profitieren?
Theresa Schlegel: Die hybride Lehre hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen und kann dazu beitragen, die Lehre inklusiver und internationaler zu gestalten, darüber hinaus eröffnet sie neue didaktische Möglichkeiten. Durch den Einsatz moderner Kamera- und Mikrofontechnik wird ein bidirektionaler Austausch der Teilnehmenden vor Ort und der aus der Ferne Teilnehmenden ermöglicht. So ist trotz der örtlichen Trennung Interaktion möglich.
Inwiefern leistet das Projekt einen Beitrag zu mehr Barrierefreiheit, Inklusion und Internationalisierung der Lehre am KIT – und welche nächsten Schritte sind in diesem Zusammenhang geplant?
Viktoria Fitterer: Manche Lehrräume sind barrierefrei, andere nicht. Zudem gibt es Unterschiede für Lehrende und Lernende, ein Raum ist für einen Studenten im Rollstuhl geeignet, aber nicht für eine Dozentin, weil eine Stufe den Zugang zum Pult versperrt. Wir haben im Laufe des Projektes erkannt, dass den Menschen, die auf einen barrierefreien Campus angewiesen sind, diese Information fehlt. Das werden wir Schritt für Schritt lösen, wenn wir die Räume für die neue Ausstattung betrachten und dann entsprechend umsetzen.
Theresa Schlegel: Selbstverständlich profitiert auch die Internationalisierung durch hybride Lehre sehr, da Zusammenarbeit über räumliche Grenzen hinweg möglich ist. Auch technische Hilfsmittel wie digitale Übersetzungsprogramme sind so deutlich einfacher einsetzbar.
Gab es spannende Ideen, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht in die Umsetzung eingehen?
Viktoria Fitterer: Natürlich ist immer noch mehr möglich, flexible Tischordnungen in großen Hörsälen zum Beispiel. Das setzen wir dafür in kleineren Lernräumen um. Grundsätzlich sind wir mit unseren Plänen aber sehr zufrieden, die größte Herausforderung bleibt die zügige Umsetzung, da sich auch das Rad der Technik ständig weiterdreht.
Theresa Schlegel: Da stimme ich Frau Fitterer zu, wir sind gut aufgestellt, haben die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer optimal berücksichtigt. Jetzt gilt es, die Pläne auch in die Tat umzusetzen und gleichzeitig die technologischen Neuerungen im Blick zu behalten und zu integrieren.
Abschließend eine persönliche Frage: Was war Ihr persönliches Highlight oder die größte Erkenntnis während der Arbeit an diesem innovativen Projekt?
Theresa Schlegel: Dank der interdisziplinären Zusammenarbeit aller Beteiligten hat das Projekt und insbesondere das Ergebnis enorm profitiert. Wir haben uns nicht auf die Medientechnik begrenzt, sondern von Anfang an den langfristigen Betrieb, den Support, die Kommunikation sowie zielgerichtete Informationsplattformen in den Blick genommen.
Viktoria Fitterer: Ich schaue auch gerne auf das Entstehen eines gegenseitigen Verständnisses zurück. Mehr über die Erwartungen, Wünsche aber auch Notwendigkeiten der Lehrenden zu erfahren, war meine größte Erkenntnis.
(NL02/2025)