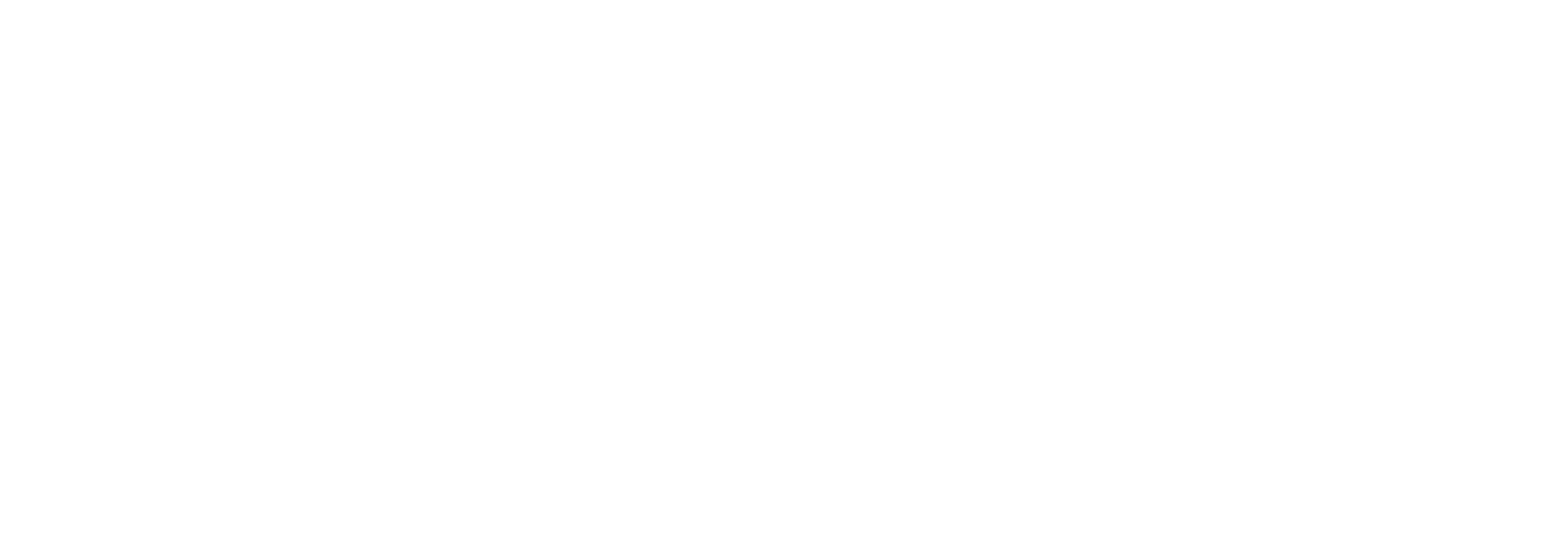Folge 24: Prof. Dr. Alexander Mädche
Prof. Dr. Alexander Mädche ist Wirtschaftsinformatik-Professor am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und leitet dort das Human-Centered Systems Lab am Institut für Wirtschaftsinformatik (WIN). Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Gestaltung menschzentrierter Systeme und positioniert sich an der Schnittstelle von Wirtschaftsinformatik und Mensch-Computer-Interaktion (HCI).
Das Projekt MenschKI! untersucht die Auswirkungen der Einführung und Nutzung von generativer KI auf Mitarbeitende. Welche praktischen Lösungen entwickeln Sie, um Mitarbeitende für den effektiven Einsatz von generativer KI zu befähigen?
Ein wichtiger Ansatz im Projekt ist, integriertes informelles Lernen während der Nutzung von generativer KI zu ermöglichen. Die Idee dabei ist, dass Generative KI nicht einfach nur Anfragen beantwortet, sondern während der Nutzung kontinuierlich Mitarbeitende dazu befähigt, eine effektive Nutzung zu erzielen. Beispielsweise haben wir durch eine Kooperation mit der EnBW einen Assistenten entwickelt, welcher einen natürlichsprachlichen Zugriff auf Unternehmensdaten ermöglicht. Wir haben in diesem Assistenten einen Baustein für informelles Lernen integriert: Damit erklärt der Assistent nicht nur die Vorgehensweise bei der Bearbeitung der Anfrage, sondern gibt zusätzlich auch proaktiv Tipps hinsichtlich der verfügbaren Daten und weiterführenden Nutzungsmöglichkeiten.
Welche langfristigen Auswirkungen auf die Arbeitswelt erwarten Sie durch die Integration von generativer KI? Wie können sich Unternehmen und Mitarbeitende darauf vorbereiten?
Ich sehe große Chancen durch die Integration von generativer KI in die Arbeitswelt, aber gleichzeitig auch Risiken. Wenn man die Entwicklung positiv betrachtet, kann man argumentieren, dass mittels generativer KI viele Aufgaben einfach schneller und mit geringerem Ressourceneinsatz bearbeitet werden können und damit ganz generell der Automatisierungsgrad erhöht werden kann. Gleichzeitig stellt sich die Frage, welche positiven und negativen langfristigen Auswirkungen dies auf Mitarbeitende und Unternehmen hat. Es ist schwierig, sich darauf vorzubereiten. Ich denke, entscheidend ist, die neuen Technologien in einem kontrollierten Rahmen zu testen und ihre Anwendung kritisch zu reflektieren. Aus wissenschaftlicher Sicht versuchen wir, auf Basis von Experimentalstudien im Labor und im Feld unter der Beteiligung von Menschen hier bessere wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu erzielen.
Sie verfügen über umfangreiche Industrieerfahrungen. Wie lassen sich diese Erfahrungen in die Hochschullehre einbringen, und auf welche Weise kann dies die Gestaltung von Lehrveranstaltungen oder Lernumgebungen verändern?
Mir war es persönlich immer wichtig, eine Brücke zwischen Theorie und Praxis in Forschung und Lehre zu schlagen. Beispielsweise haben wir in der Lehre bereits vor über 15 Jahren das Konzept der Capstone-Projekte in unsere Vorlesungen integriert. Hier kooperieren wir mit Praxispartnern, welche ein reales Problem artikulieren. Die Studierenden arbeiten in Teams daran, eine Lösung unter Verwendung von Methoden und Theorien aus der Vorlesung zu realisieren. Ich glaube generell, dass es unsere Aufgabe ist, den Studierenden beizubringen, dass wissenschaftliche Methoden und Theorien durchaus relevant für die Praxis sind.
Projekte wie die App Amsl unterstützen Studierende beim selbstregulierten Lernen und beim Umgang mit Prüfungsstress. Welche Rolle könnten KI-gestützte Systeme in Zukunft spielen, um individuelle Lernbedarfe noch gezielter zu adressieren?
Ich glaube, KI-basierte Lernassistenten werden zukünftig eine wichtige Rolle in der personalisierten Vermittlung fachlicher und überfachlicher Inhalte spielen. Wir verzahnen beispielsweise in der Amsl nun auch fachliche Inhalte aus konkreten Vorlesungen mit überfachlichen Inhalten, wie zum Beispiel selbstreguliertes Lernen. In unseren aktuellen Forschungsarbeiten nutzen wir auch Biosignale zur Erfassung von Blickbewegungen und Herzaktivität, um auf diese Weise kognitive und affektive Zustände von Studierenden zu erkennen und dadurch die Lerninhalte noch besser zuschneiden zu können. Bei den ganzen technischen Möglichkeiten unter Verwendung von Sensorik und KI sollten wir eine Sache nicht vergessen: Menschen sind soziale Wesen, welche auf zwischenmenschliche Interaktion angewiesen sind. Ich bin daher der Meinung, dass beispielsweise physische Vorlesungen, Lerngruppen, Hochschulgruppen oder der Austausch in der Mensa nicht auf der Strecke bleiben sollten. Das versuche ich auch den Studierenden mitzugeben.
Zum Schluss noch eine „persönliche“ Frage: Wie nutzen Sie generative KI? Gibt es spezifischen Anwendungen oder Tools, die sich als besonders hilfreich erwiesen haben?
Ich nutze (generative) KI beim Schreiben, insbesondere für die Übersetzung und bei der sprachlichen Verbesserung von Sätzen. Generative KI ist recht gut darin, alternative Formulierungsvorschläge zu unterbreiten. Das zeigt sich beispielsweise auch bei der Exploration von Titeln für Forschungsprojekte oder Softwaretools. Ich lasse mir auch regelmäßig Zusammenfassungen zu verschiedenen Themenbereichen erstellen.
Unabhängig davon habe ich gegenüber generativer KI immer noch ein gesundes Misstrauen. Ich glaube auch, dass die Fähigkeit der kritischen Reflexion KI-generierter Inhalte in Zukunft noch wichtiger wird, beziehungsweise bleibt.
(NL03/25)